
Die schönste Nebensache der Welt Das Lesen als zivilisatorische Grundbedingung
Text Michael Stavarič Fotos Kourosh Qaffari | Archiv Stavarič
Kennen Sie auch dieses Gefühl, dass man zu lesen beginnt und vollkommen in ein Buch einzutauchen imstande ist? Plötzlich ist Ihr Kopf voller „eigengenerierter“ Bilder, Sie identifizieren sich mit einem Protagonisten, Sie interpretieren und deuten die erzählte Geschichte neu, Sie erzählen sie vielleicht sogar weiter und empfehlen diese Ihren
Freunden oder Bekannten. Und – möglicherweise – denken Sie auch noch Jahre später an besagte Lektüre, oder nehmen das Buch regelmäßig zur Hand, weil es sich ohnehin in Ihrer persönlichen Bibliothek wiederfindet. Und glauben Sie mir, ich will jetzt gar nicht erst mit der Leier beginnen, wie oft ich mich in Wohnungen/Häusern wiederfinde, wo es gar keine Bücherregale mehr gibt …
Als ich noch ein Kind war, fielen mir einst im Wochenendhäuschen meiner Großeltern väterlicherseits einige Bücher in deren Bibliothek auf, die ich unbedingt lesen beziehungsweise zumindest durchblättern wollte. Ich war etwa fünf Jahre alt, und die Vorstellung, dass ich schon bald in Österreich und nicht mehr in der Tschechoslowakei leben und Deutsch sprechen und später sogar schreiben würde … Nun, was soll ich sagen, das war vollkommen absurd. Besagte Bücher durfte ich allesamt in die Hand nehmen (es handelte sich vorwiegend um Lexika, Gedichte und Kriminalromane), doch eines der Werke blieb nach wie vor unerreichbar im Regal verwahrt.
Man erzählte mir, dafür sei ich zu jung, so dass ich heute lediglich den Einband zu beschreiben weiß. Abgesehen vom ausgesprochenem Verbot, lag es wohl an diesem Umschlag, dass mich gerade jenes Buch interessierte, denn es zeigte einen bleichen Mann mit spitzen Eckzähnen in einem schwarzen Mantel mit rotem Innenfutter sowie ein überaus muskulös-kantiges, grünliches Wesen, das den Mann mit den Eckzähnen um einiges überragte. Dieses Wesen trug übergroße Narben im Gesicht und seine Hände sahen danach aus, als könnte es ohne Weiteres ein Pferd in dessen Leibesmitte auseinanderreißen. Worum es in der konkreten Geschichte ging, sollte ich nie erfahren, meine Eltern emigrierten und ich habe das Buch nie wieder gesehen. Allerdings kamen mir die beiden Akteure auf dem Einband auch in Österreich unter, viel später zwar erst, als ich bereits größer war, doch durfte ich dann immerhin alles über und von diesen beiden literarischen Gestalten lesen: Graf Dracula & Frankenstein. Eigentlich ja Frankenstein’s Monster.
Neben etlicher Populärliteratur, die ich während dieser Zeit las – und um solche handelte es sich wohl auch damals bei meinen Großeltern – hielt ich schon bald die Originalbücher zu den darauf basierenden Sujets in den Händen: Bram Stokers „Dracula“ und Mary Shelleys „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“. Natürlich verschlang ich die beiden Lektüren förmlich und sie wurden gewissermaßen zu Eckpfeilern meiner Jugendliteratur. Bald schon sah ich mir auch allerlei Verfilmungen zu dem Thema an, vor allem die Klassiker hatten es mir angetan: Der hölzerne Nosferatu, der für mich identisch mit Dracula war, und Boris Karloff als steif herumstapfendes, nicht unbedingt intelligentestes Monster hatten mich in ihren Bann gezogen.
Auch die Leben und die Lebensverläufe der beiden Schriftsteller fand ich plötzlich überaus interessant; ich las Bücher über die beiden Persönlichkeiten zumindest genau so gern wie ihre literarischen Werke. Bram Stoker war bis zu seinem siebten Lebensjahr krank – in diesem Alter kam ich nach Österreich –, er konnte bis dahin weder alleine aufrecht stehen noch selbständig gehen, und es hieß fortan, dass sich diese traumatischen Erfahrungen in seinen literarischen Arbeiten widerspiegelten, ergo: Der ewige Schlaf, die Schwäche, die Blässe und die Wiederauferstehung von den Toten. Sein persönliches Schicksal inspirierte ihn also nicht zuletzt maßgeblich für besagtes Opus Magnum. Ab dem siebten Lebensjahr ging es nämlich gesundheitlich aufwärts mit ihm, was die Ärzte damals für ein Wunder hielten, und später ehelichte er sogar eine gewisse Florence Balcombe, eine Dame, die auch von Oscar Wilde aufs Heftigste umworben wurde. Der einst kränkliche Junge, dem niemand allzugroße Überlebenschancen einräumte, schnappte demnach als Mann dem wohl bekanntesten Dandy seiner Zeit die Frau vor der Nase weg.
An Mary Shelleys Lebensgeschichte gefiel mir unter anderem, dass sie schlussendlich ihren zeitlebens berühmteren Mann, den Dichter Percy Shelley, der viel mit Lord Byron und Co. abhing, in den Schatten stellte. Ich meine, wer kennt heute noch die Literatur von P.B. Shelley, Byron & Co, wohingegen allen Dr. Frankenstein für alle Zeiten ein Begriff sein dürfte. Ich meine, was für eine gewaltige, zeitlose Geschichte ist da Mary Shelley gelungen, die praktisch alles beinhaltet, was uns im existenzielleren Sinne nahegeht. Und erst die eigentliche Metamorphose, die wohl zugleich einen der Gipfelpunkte menschlicher Hybris darstellt: Tote zum Leben zu erwecken. Fortan kein Mensch mehr zu sein, vielmehr Gott.
Worauf ich eigentlich hinaus will, werte Leserinnen und Leser? Tja, ich wäre nicht der Mensch, der ich bin, hätte ich nicht die Bücher gelesen, die ich nun einmal las! Wenn man so will, sind diese ersten echten „Leseabenteuer“ meinerseits, samt ihrer Folgen, symptomatisch für das Lesen an sich: Lesen und Bücher machen etwas mit einem, sie bewirken tatsächlich und nachweislich etwas. Sie sind wahrlich Orte voller Abenteuer, welche die Fantasie beflügeln, sie erwecken die Neugier (aufs Leben), erweitern Empathie und Sprachvermögen, sie sind identitätsstiftende Medien durch und durch. Und es ist nun wahrlich kein Geheimnis: Das Lesen und Schreiben ist eine zivilisatorische
Grundbedingung, ohne die der moderne Mensch undenkbar bleibt. Und auch nur am Rande: Das Buch bleibt auf lange Sicht das verlässlichste Speichermedium überhaupt. Oder können Sie sich ernsthaft vorstellen, dass in tausend Jahren unsere digitale Welt mit ihren uns bekannten Formaten nach wie vor existiert? Allein wenn ich die Entwicklung während meiner Lebensspanne betrachte: Meine ersten digitalen Texte speicherte ich noch auf Floppy-Discs, ein unlesbares und heute längst vergessenes Speichermedium; ein Buch hingegen bleibt auch nach tausend Jahren analog erhalten und grundsätzlich lesbar.
Und ich erzähle Ihnen noch etwas über dieses „Lesen an sich“: Oft genug nahm ich während meines Lebens Bücher zur Hand, die ich beim besten Willen nicht verstand. Mühsame, zumeist abgebrochene Lektüren, die ich oft genug für Zeitverschwendung hielt. Ab und an las ich (ein, zwei Jahrzehnte später) erneut besagtes Werk an und plötzlich begriff ich alles … Mitunter erschließen sich einem Dinge und Kontexte tatsächlich erst mit den Jahren, so dass man über sich selber staunt. Ist das nicht beinahe schon ein kleines Wunder? Und veranschaulichen bzw. reflektieren Bücher so gesehen nicht ganz vortrefflich unsere Menschwerdung, mit all den gemachten Erfahrungen, Ereignissen und Komplexitäten?
Gewiss bin ich mir dessen bewusst, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, in der nicht mehr mit dieser Selbstverständlichkeit gelesen wird; und dort, wo noch gelesen wird, meint dies eher Genre-Bücher wie Krimis, Thriller, Fantasy & Co. Was im Übrigen vollkommen in Ordnung ist – die Komplexität der Welt und die anhängigen Fragen lassen sich in jedwedem Genre vermitteln, nicht zuletzt auch in gut gemachten Filmen, Serien oder Computerspielen, die dem Medium Literatur freilich zusetzen. Als Schriftsteller plädiere ich dafür, sich als weltoffener Mensch auch der Belletristik zu widmen: Man sollte regelmäßig Romane quer durch alle Jahrhunderte, Epen, Dramen, Lyrik, Essays, Märchen und vielfältigste, ästhetisch anspruchsvollere Kinderbücher lesen. Zeitungen nicht zu vergessen, denn schlussendlich ist es die Vielfalt, mit der man sich „lesetechnisch“ umgibt, die einen umfassenderen Blick über den eigenen Tellerrand bedingt und/oder diesen überhaupt ermöglicht.
Vielleicht sind diese Überlegungen mit ein Grund, warum ich in den letzten Jahren vermehrt Kinderbücher schreibe (und lese), die möglichst vielen Ansprüchen gerecht werden, und die ein jüngeres Publikum an komplexere Leseabenteuer heranführen sollen. Für Sie hingegen, werte Leserinnen und Leser, habe ich abschließend etwas anderes parat – ich empfehle Ihnen einige Bücher, die mein Leben & Leseverhalten geprägt und verändert haben. Vielleicht ergeht es Ihnen ja am Ende ganz ähnlich? Die ultimative Michael-Stavarič-Leseliste (und ich publiziere diese zum ersten Mal) lautet demnach:
1. Wenedikt Jerofejew: „Die Reise nach Petuschki“; 2. Michail Bulgakov: „Der Meister und Margarita“; 3. Bohumil Hrabal: „Allzulaute Einsamkeit“; 4. Patrik Ourednik: „Europeana“; 5. Wolf Erlbruch: „Ente, Tod und Tulpe“; 6. Umberto Eco: „Das Foucaultsche Pendel“; 7. Anne Carson: „Rot“; 8. George Saunders: „Fuchs 8“; 9. Kevin Vennemann: „Nahe Jedenew“; 10. Herman Melville: „Moby Dick“.
Und sollten Sie diese Bücher tatsächlich auf Ihre persönliche Leseliste setzen, sollte eines nicht unerwähnt bleiben: Bücher verraten einem, mit welchen Menschen man es zu tun hat; denn, wenn Sie so wollen, nach besagten Lektüren wissen Sie ziemlich alles über mich. Sind nicht Bücher (und die Literatur) somit das Erstaunlichste, was die Welt zu bieten hat? Und sind sie nicht unerlässliche Mittel, die ein prosperierendes Miteinander ermöglichen? Oder lassen Sie es mich abschließend mit den Worten von Jorge Luis Borges auf den Punkt bringen: „Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn.“

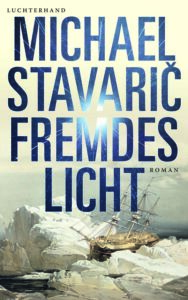
Michael Stavarič, geb. 1972 in Brno (Tschechoslowakei), lebt als freier Schriftsteller in Wien. Zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen, zuletzt: Adelbert-von-Chamisso-Preis, Österreichischer Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur. Lehraufträge zuletzt: Stefan Zweig Poetikdozentur an der Universität Salzburg. Aktuelle Publikationen: „Gotland“, Roman, Luchterhand, München 2017.
